Es findet eine dramatische politische Verschiebung statt: Rassismus und Menschenverachtung werden gesellschaftsfähig. Was gestern noch undenkbar war und als unsagbar galt, ist kurz darauf Realität. Humanität und Menschenrechte, Religionsfreiheit und Rechtsstaat werden offen angegriffen. Es ist ein Angriff, der uns allen gilt.
Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden. Wir halten dagegen, wenn Grund- und Freiheitsrechte weiter eingeschränkt werden sollen.
Das Sterben von Menschen auf der Flucht nach Europa darf nicht Teil unserer Normalität werden. Europa ist von einer nationalistischen Stimmung der Entsolidarisierung und Ausgrenzung erfasst. Kritik an diesen unmenschlichen Verhältnissen wird gezielt als realitätsfremd diffamiert.
Während der Staat sogenannte Sicherheitsgesetze verschärft, die Überwachung ausbaut und so Stärke markiert, ist das Sozialsystem von Schwäche gekennzeichnet: Millionen leiden darunter, dass viel zu wenig investiert wird, etwa in Pflege, Gesundheit, Kinderbetreuung und Bildung. Unzählige Menschen werden jährlich aus ihren Wohnungen vertrieben. Die Umverteilung von unten nach oben wurde seit der Agenda 2010 massiv vorangetrieben. Steuerlich begünstigte Milliardengewinne der Wirtschaft stehen einem der größten Niedriglohnsektoren Europas und der Verarmung benachteiligter Menschen gegenüber.
Nicht mit uns – Wir halten dagegen!
Wir treten für eine offene und solidarische Gesellschaft ein, in der Menschenrechte unteilbar, in der vielfältige und selbstbestimmte Lebensentwürfe selbstverständlich sind. Wir stellen uns gegen jegliche Form von Diskriminierung und Hetze. Gemeinsam treten wir antimuslimischem Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Antifeminismus und LGBTIQ*- Feindlichkeit entschieden entgegen.
Wir sind jetzt schon viele, die sich einsetzen:
Ob an den Außengrenzen Europas, ob vor Ort in Organisationen von Geflüchteten und in Willkommensinitiativen, ob in queer-feministischen, antirassistischen Bewegungen, in Migrant*innenorganisationen, in Gewerkschaften, in Verbänden, NGOs, Religionsgemeinschaften, Vereinen und Nachbarschaften, ob in dem Engagement gegen Wohnungsnot, Verdrängung, Pflegenotstand, gegen Überwachung und Gesetzesverschärfungen oder gegen die Entrechtung von Geflüchteten – an vielen Orten sind Menschen aktiv, die sich zur Wehr setzen gegen Diskriminierung, Kriminalisierung und Ausgrenzung.
Gemeinsam werden wir die solidarische Gesellschaft sichtbar machen! Am 13. Oktober wird von Berlin ein klares Signal ausgehen.
#unteilbar Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung Demonstration: 13. Oktober 2018 – 13:00 Uhr Berlin
Für ein Europa der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit!
Für ein solidarisches und soziales Miteinander statt Ausgrenzung und Rassismus!
Für das Recht auf Schutz und Asyl – Gegen die Abschottung Europas!
Für eine freie und vielfältige Gesellschaft!
Solidarität kennt keine Grenzen!
#unteilbar Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung!

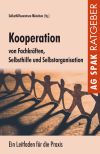

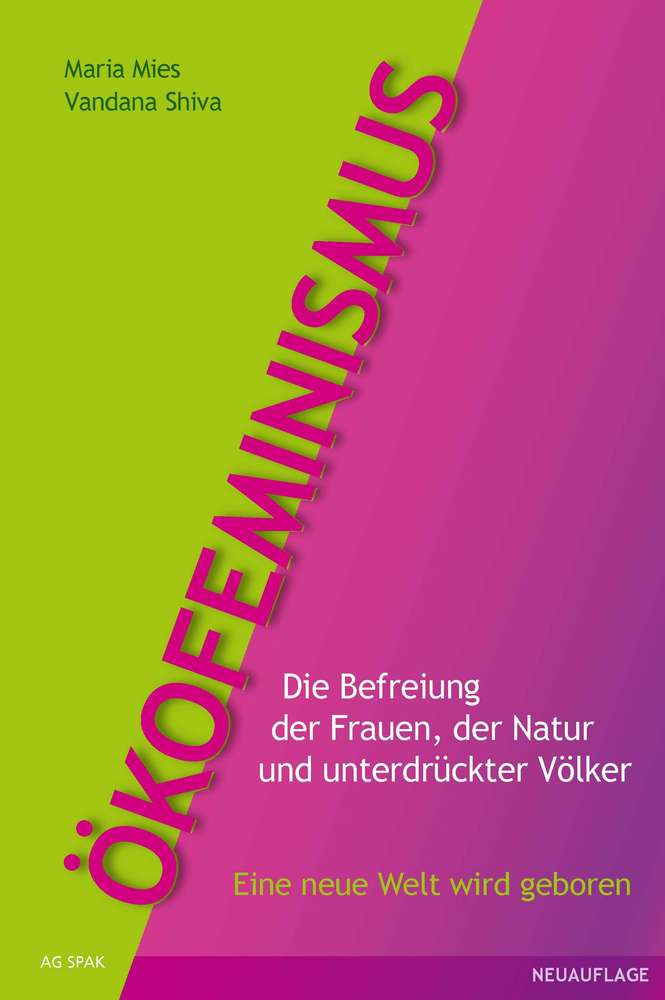

 Patientenvertretung setzt sich erfolgreich für Psychotherapie bei Menschen mit geistiger Behinderung ein
Patientenvertretung setzt sich erfolgreich für Psychotherapie bei Menschen mit geistiger Behinderung ein






